
Wie interagieren Pilze, Bakterien und andere Mikroorganismen in der Pflanzenwelt miteinander? Welche Möglichkeiten bieten diese Interaktionen für wichtige Zukunftsfragen wie beispielsweise Pflanzenschutz und Klimaanpassung? Dazu fand am 27. und 28. März 2025 in Braunschweig der zweite Workshop „Microbial Interactions in the Phytosphere“ statt. Ca. 60 Wissenschaftler*innen nahmen an der Tagung im Braunschweiger Zentrum für Systembiologie (BRICS) teil und erkundeten gemeinsam die Potenziale mikrobieller Interaktion. Prof. Dr. André Fleißner, Leiter der Arbeitsgruppe Pilzgenetik am Institut für Genetik der Technischen Universität Braunschweig und Teil des Organisationsteams des Workshops, hat mit uns über die Bedeutung von Mikroorganismen für die Pflanzengesundheit und die Wichtigkeit von Netzwerken in diesem Forschungsfeld gesprochen.
Mikroorganismen elementar für Pflanzengesundheit
„Pflanzen sind immer mit Mikroorganismen assoziiert. Auf ihnen leben zum Beispiel eine Vielzahl von Bakterien und Pilzen. Wir glauben, dass das Zusammenspiel zwischen Pflanze und Mikroorganismen von ähnlicher Bedeutung sein könnte, wie das Mikrobiom im menschlichen Darm. Die Bakterien im Darm sind ein wichtiger Faktor für die menschliche Gesundheit. So ist es auch bei Pflanzen. Je nachdem, welche Mikroorganismen auf ihr leben, desto gesünder oder weniger gesund ist die Pflanze“, erklärt Prof. Dr. André Fleißner.
Nicht nur das quantitative Verhältnis von Bakterien, Pilzen und anderen Mikroorganismen spielt dabei eine Rolle, sondern auch deren Zusammenspiel untereinander. Ein Beispiel wie wichtig mikrobielle Interaktionen sein können, zeigt ein Experiment zum Befall von Bohnenpflanzen durch Grauschimmel. Wird ein Bohnenblatt auf der Oberfläche mit Grauschimmel infiziert, folgt normalerweise eine Ausbreitung des Pilzes und die Zerstörung des Blattgewebes. Unter Laborbedingungen konnte die Ausbreitung des Pathogens nun aber durch Hinzugabe eines zweiten Pilzes verhindert werden. „Zuerst haben wir angenommen, der zweite Pilz tötet den Grauschimmel. Aber das war nicht der Fall. Es fand vielmehr eine Art Umprogrammierung des Grauschimmels statt, so dass er die Pflanze nicht mehr infiziert hat“, so Fleißner. „Diese mikrobiellen Interaktionen sind noch viel zu wenig erforscht und bieten enorme Potenziale unter anderem im nachhaltigen Pflanzenschutz.“
Klimawandel verschärft Fragestellung
Die Bedeutung mikrobieller Interaktionen gewinnt durch die Folgen des Klimawandels immer weiter an Gewicht. „Trockenstress, hohe Temperaturen und Extremwetterereignisse schwächen die Abwehrkräfte von Pflanzen, sodass sie anfälliger für Krankheitserreger werden“, berichtet Prof. Fleißner und nennt als Beispiel einen Besuch auf einer Pinienplantage in Südafrika, auf der zahlreiche Bäume durch einen Pilz befallen wurden und abstarben. Als Grund hierfür konnten die Forscher*innen Schäden durch einen Hagelsturm an der Baumrinde identifizieren, die das Immunsystem der Pinien geschwächt und sie so anfällig für Krankheitserreger gemacht haben.
Aber auch eigentlich harmlose Pilze, die beispielsweise in Kiefern vorkommen, können durch die Folgen des Klimawandels pathogen und somit gefährlich für den Baum werden. „Die Abwehrkräfte der Kiefer halten beispielsweise den Pilz Diplodia sapinea im gesunden Zustand normalerweise in einem Gleichgewicht, in dem beide Seiten symbiotischen leben können. Werden die Abwehrkräfte aber durch Trockenstress und Hitze geschwächt, kippt das Gleichgewicht, sodass der Pilz die Kiefer letztendlich umbringt“, so Fleißner.
Ein weiterer Faktor, der der Forschung weiteren Auftrieb verleiht, ist der Green Deal der Europäischen Union zur nachhaltigen Landwirtschaft. Durch den Deal soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert werden. Somit müssen alternative und umweltfreundliche Pflanzenschutzmöglichkeiten gefunden werden. Der Einsatz von Mikroorganismen könnte hier zukünftig eine Alternative sein.
Vernetzung hebt Potenziale
Allein in Braunschweig forschen mit dem Institut für Genetik und dem Institut für Mikrobiologie der Technischen Universität Braunschweig, dem Julius Kühn-Institut, dem Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, dem Thünen-Institut und dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung mehrere Arbeitsgruppen an mikrobiellen Interaktion. Der Workshop „Microbial Interactions in the Phytosphere“ soll nun die Vernetzung in Braunschweig, aber auch darüber hinaus stärken und so letztendlich die Forschung rund um mikrobielle Interaktionen voranbringen, so Fleißner: „Jede*r Wissenschaftler*in in dem Workshop betrachtet den Forschungsgegenstand aus einer unterschiedlichen Perspektive. Aber letztendlich forschen wir alle zu mikrobiellen Interaktionen. Wenn wir uns hier noch stärker vernetzen und voneinander lernen, kann das helfen, die Potenziale der mikrobiellen Interaktionen zu verstehen und weiter nutzbar zu machen. Darum haben wir diesen Workshop in Kooperation mit dem Julius Kühn-Institut und dem Zentrum Klimaforschung Niedersachsen organisiert. Der Standort Braunschweig bietet enormes Potenzial zur Erforschung dieser wichtigen Fragestellung. Dieses Potenzial werden wir in Zukunft strategisch erschließen.
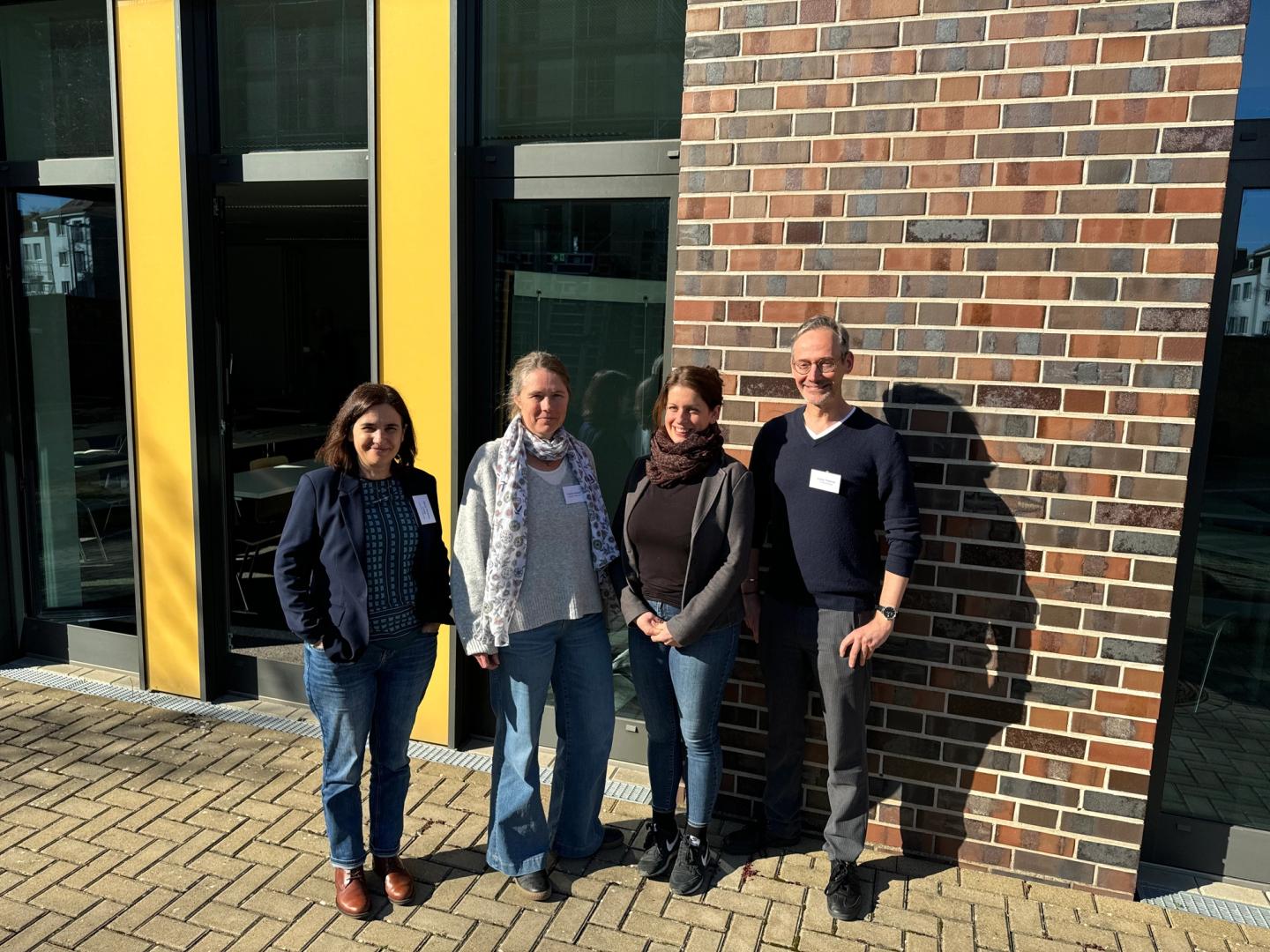
Ansprechpartner:innen
- Dr. Yvonne BeckerInstitut für Epidemiologie und Pathogendiagnostik, Julius Kühn-Institut
- Prof. Dr. André FleißnerInstitut für Genetik der Technischen Universität Braunschweig
- Dr. Maria Pimenta LangeInstitut für Pflanzenschutz in Gartenbau und urbanem Grün, Julius Kühn-Institut
 Katharina Zickwolf, M.A. / M.A.Geschäftsführerin
Katharina Zickwolf, M.A. / M.A.Geschäftsführerin
Weitere News
AlleStellenausschreibung des ZKfN
Das ZKfN sucht eine*n Referent*in für Dialog und Transfer zur Stärkung des Austauschs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft in der Klima- und Klimaforschung in Niedersachsen.
1 min. Lesezeit
Klimarisikoanalyse für Niedersachsen 2025
Das NIKO hat die Klimarisikoanalyse für Niedersachsen 2025 veröffentlicht – 42 bewertete Risiken als Grundlage für die Klimaanpassung.
2 min. Lesezeit
Einladung zur Werkstatt der Mutigen
Auftakt für das Ecosystem Social Sustainability (ESS)
2 min. Lesezeit